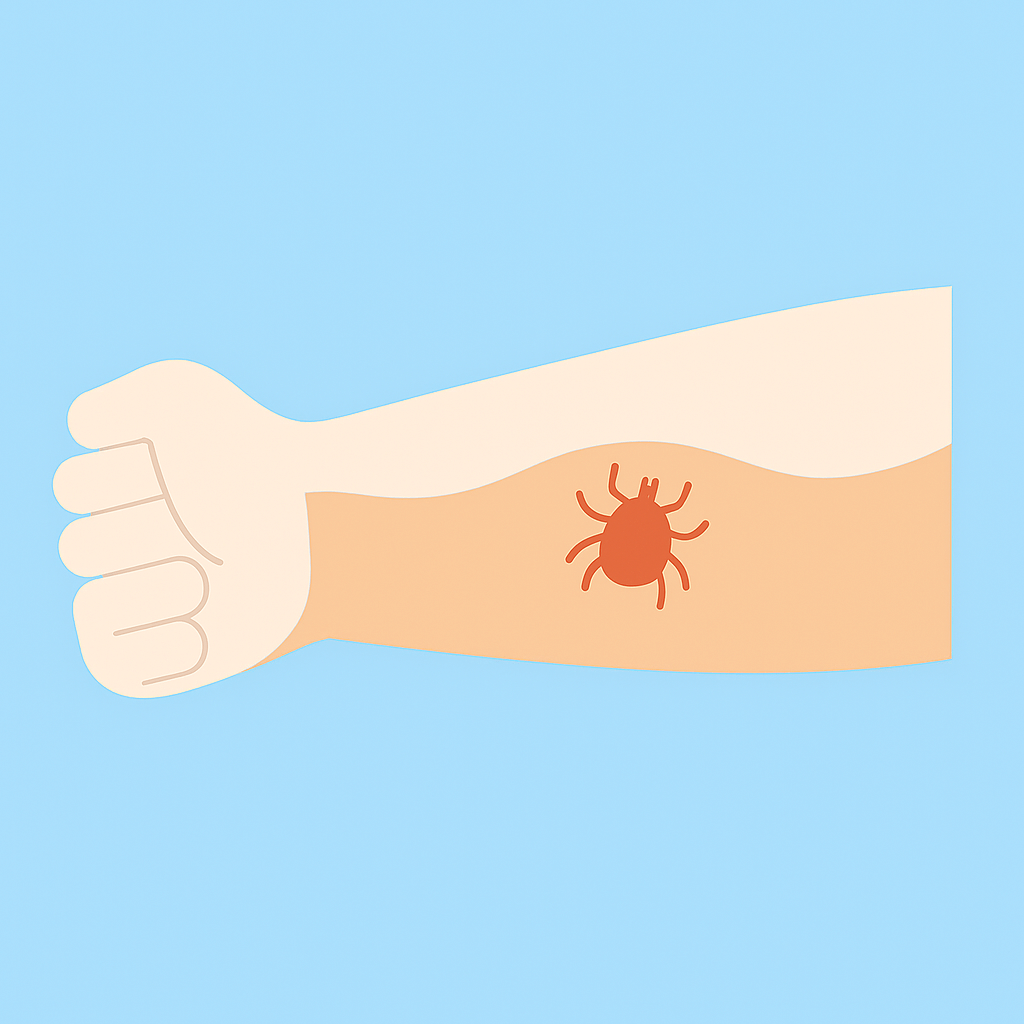
Zusammenfassung:
Nein, das können sie nicht. Hausstaubmilben sind winzige, 0,1–0,5 mm große Spinnentiere, die in unserer Wohnumgebung leben und sich von abgestorbenen Hautschuppen ernähren [1]. Sie besitzen keine Vorrichtungen, um die Haut zu durchdringen – sie beißen oder stechen nicht und übertragen keine Krankheiten [2]. Ihre Körperbestandteile und ihr Kot enthalten jedoch Allergene (z. B. Der p1, Der p2), die bei empfindlichen Menschen Juckreiz, Hautrötungen oder Neurodermitis-Schübe auslösen können [3][4].
Hausstaubmilben und Hautkontakt – das solltest du wissen
Wo Hausstaubmilben leben – und warum sie nicht auf der Haut vorkommen
Hausstaubmilben leben nicht auf dem Menschen, sondern in Matratzen, Teppichen und Textilien. Sie bevorzugen warm-feuchte Bedingungen (70–80 % Luftfeuchtigkeit, über 25 °C) [1]. Auf der menschlichen Haut fehlen ihnen Nahrung, Feuchtigkeit – und ein Stechapparat [2]. Daher können sie weder beißen noch in die Haut eindringen.
Fazit: Hausstaubmilben leben in unserer Umgebung, nicht auf der Haut. Sie sind keine Parasiten, sondern harmlose Mitbewohner – solange ihre Allergene nicht zum Problem werden.
Wie Hausstaubmilben-Allergene die Haut reizen können
Das eigentliche Problem liegt in den Allergenen des Milbenkots. Sie enthalten enzymatische Proteine wie Der p1 oder Der p2, die das Immunsystem bei empfindlichen Personen aktivieren [3]. Das führt zu einer Histaminfreisetzung, die Juckreiz, Rötung und Quaddeln verursacht [5]. Hausstaubmilben-Allergene können so bei Allergikern eine allergische Dermatitis oder Neurodermitis-Schübe auslösen [4].
Wie Milbenenzyme die Hautbarriere schwächen
Neuere Studien zeigen, dass Milbenenzyme die Hautbarriere beeinflussen können: Das Hauptallergen Der f 1 spaltet Strukturproteine der Hornschicht und schwächt so die natürliche Schutzfunktion der Haut [9]. Dadurch wird sie durchlässiger für Reizstoffe und Allergene.
Eine weitere Untersuchung belegt, dass eine Milben-Phospholipase Hautlipide verändert und dadurch Immunzellen aktiviert [11]. Das Hautprotein Filaggrin kann diese Reaktion normalerweise abfangen – bei Menschen mit Filaggrin-Mangel (z. B. Neurodermitis) fehlt dieser Schutz [12].
Das bedeutet: Hausstaubmilben dringen nicht in die Haut ein, doch ihre Enzyme können die Hautbarriere schwächen – und so allergische Reaktionen fördern [9][11][12].
Andere Milbenarten, die tatsächlich in der Haut leben
Einige Milbenarten leben tatsächlich auf oder in der Haut – im Gegensatz zur Hausstaubmilbe:
- Krätzmilben (Sarcoptes scabiei): graben Gänge in die oberste Hautschicht und verursachen die Krätze, eine hochansteckende Hautinfektion mit starkem nächtlichem Juckreiz [16–21].
- Haarbalgmilben (Demodex folliculorum): leben in Haarfollikeln und Talgdrüsen, meist im Gesicht. In kleiner Zahl harmlos, bei Überwucherung entzündlich [24–32].
Hausstaubmilben hingegen sind keine Parasiten – sie reizen die Haut ausschließlich über ihre allergenen Stoffwechselprodukte.
Encasings – der wichtigste Schutz vor Hausstaubmilben
Hausstaubmilben lieben Matratzen, Kissen und Decken – dort ist es warm, feucht und voller Hautschuppen. Mit sogenannten Encasings, also milbendichten Schutzbezügen, kannst du sie wirksam fernhalten.
Die Bezüge umhüllen Matratze, Kissen und Decke vollständig und verhindern, dass Milben und ihre Allergene nach außen gelangen. Gute Encasings sind atmungsaktiv, weich und hautfreundlich – du spürst sie kaum, aber sie schützen dich jede Nacht.
Hinweis: Wenn du passende Produkte suchst, findest du bei Bedding Bird milbendichte Encasings , die speziell für Allergiker:innen entwickelt wurden.
Mehr Tipps, wie du dein Zuhause zusätzlich milbenarm gestalten kannst, liest du im Ratgeber „Hausstaubmilben: Risiken und Schutzmöglichkeiten“ .
Fazit
Hausstaubmilben dringen nicht in die Haut ein – sie leben ausschließlich in der Umgebung. Ihre Allergene können jedoch die Haut reizen und die Barriere schwächen, besonders bei empfindlicher oder vorgeschädigter Haut. Mit Encasings, gutem Raumklima, regelmäßiger Reinigung und Hautpflege lässt sich das Risiko deutlich reduzieren.
FAQ – Häufige Fragen zu Hausstaubmilben und Haut
Können Hausstaubmilben in die Haut eindringen?
Nein. Sie besitzen keine Werkzeuge, um die Haut zu verletzen [1][2].
Warum juckt meine Haut trotzdem?
Durch eine Immunreaktion auf Milbenallergene, nicht durch Bisse [3][5].
Können Milben Neurodermitis auslösen?
Nicht direkt – aber sie können bestehende Hautprobleme verschlimmern [4][7].
Wie kann ich mich schützen?
Encasings, häufiges Waschen, Lüften und eine Luftfeuchtigkeit unter 50 % [13][14].
Leben Milben auf Kleidung?
Nur kurzzeitig – sie überleben dort nicht lange [1].
Welche Milben befallen tatsächlich die Haut?
Krätzmilben (Sarcoptes scabiei) und Haarbalgmilben (Demodex folliculorum) [16][24].
Wie schütze ich meine Hautbarriere?
Mit rückfettender Pflege, milden Reinigern und Vermeidung von zu heißem Wasser [12].
Wie erkenne ich eine Milbenallergie?
Typisch sind morgendliches Niesen, juckende Augen, Hautreizungen oder schlechter Schlaf [1][3].
Quellenverzeichnis
- ECARF – Hausstaubmilbenallergie – Infoportal
- MSD Manual Profi-Ausgabe – Milbenbisse – Bisse und Stiche
- Universimed – Bedeutung der Hausstaubmilbenallergie in der atopischen Dermatitis
- ECARF – Allergene und Hautreaktionen bei Neurodermitis
- ECARF – Allergische Reaktionen und Histaminfreisetzung
- Nakamura T. et al. (2006): Reduction of skin barrier function by proteolytic activity of a recombinant house dust mite major allergen Der f 1. J Invest Dermatol 126(12): 2719–23
- Jarrett R. et al. (2016): Filaggrin inhibits generation of CD1a neolipid antigens by house dust mite–derived phospholipase. Science Translational Medicine 8(325): 325ra18
- Jarrett R. et al. (2016): Filaggrin and Milbenenzyme – Schutz der Hautbarriere bei Neurodermitis. Science Translational Medicine 8(325): 325ra18
- Universimed – Empfehlungen zur Allergenvermeidung
- Universimed – Hypersensibilisierung und Schutzmaßnahmen
- MSD Manual – Übersicht verschiedener Milben
- World Health Organization (2023): Scabies – Fact Sheet
- Cleveland Clinic – Demodex (Face Mites) | Orphanet – Demodikose (Orpha-Nr. 283)

